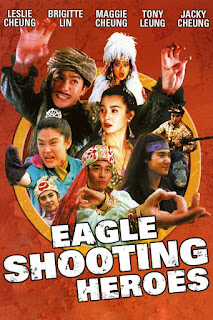Hongkong 1982
Regie:
Kuei Chih-Hung
Darsteller:
Tai Liang-Chun,
Ai Fei,
Lily Li Li-Li,
Lau Ar-Lai,
Yu Tsui-Ling,
Eric Chan Ga-Kei,
Jason Pai Piao,
Wang Lai
Wenn die grandios schrammelige Shaw Brothers-Fanfare ertönt, dann weiß der Kino-Freund in der Regel, was ihn erwartet: irgendwas mit Schwertern, Fäusten und/oder Gelben Tigern (wahlweise auch Drachen oder Panthern, je nachdem, welches Tier dem deutschen Titelschmied gerade so in den Sinn kam). Die teils sehr aufwändigen Kung-Fu-Epen waren das Aushängeschild des Studios und gewannen eine weltweite Fan-Gemeinde. Oft und gern wird dabei vergessen oder übersehen, dass das Studio auch andere Genre-Gelüste bediente. So standen auf dem Shaw-Spielplan auch solche Dinge wie Romantik [→ EINE LIEBE IN HONGKONG], Science-Fiction [→ INVASION AUS DEM INNEREN DER ERDE], Riesenmonster-Rambazamba [→ DER KOLOSS VON KONGA] – und nicht selten auch okkultistisch angehauchter Horror-Schlonz mit viel Gewürm und Gedärm. In letztere Kategory fällt auch CURSE OF EVIL. Die unfassbare Unterhaltungsbombe ist für sensible Seelen zwar nur bedingt geeignet, bietet allen anderen aber ein prächtiges Potpourri aus Schandtaten, Schleim und Schreckgestalten.
Inhalt:
Die wohlhabende chinesische Großfamilie Shi ist verflucht. Vor über 30 Jahren ermordeten ruchlose Banditen 13 ihrer Mitglieder, deren Leichen danach im Brunnen entsorgt wurden. Seitdem kommt es bei Hinterbliebenen und Nachkommen in regelmäßigem Zyklus immer wieder zu mysteriösen Todesfällen. Als nach einigen Jahren Ruhe die jüngste Shi-Tochter im Garten der Villa ein scheußliches Untier in Gestalt eines blutigen Frosches entdeckt, deutet die weise Großmutter dies als Vorbote neuen Unheils. Und sie behält Recht: In den folgenden Tagen verschwinden immer mehr Angehörige und Bedienstete, während wiederholt ein widerliches Wurm-Wesen gesichtet wird, das durch Gänge und Gemächer des Hauses kriecht.
Kritik:
CURSE OF EVIL beginnt zwar wie klassischer Geisterhaus-Grusel, wenn der Vorspann Bilder einer alten Standuhr präsentiert (die aus irgendeinem Grund in wabernde Rauchschwaden gehüllt wurde), macht jedoch relativ schnell klar, dass ihm an einer subtilen Abarbeitung der Ereignisse kaum gelegen ist. Ein Erzähler erläutert in aller Eile die schicksalhafte Vorgeschichte, dann wird man auch schon Zeuge des ersten gewaltsamen Ablebens – nur echt mit wildem Gezappel und ordentlich Schaum vor der Schnute. Kein ineffektiver Auftakt, aber noch harmlos im Vergleich zu den teils recht derben Momenten, die einen im weiteren Verlauf erwarten. Da werden wehrlose Menschen von fiesen kleinen Frosch-Monstern bei lebendigem Leibe verknuspert oder – als Gipfel der Geschmacklosigkeit – hilflose junge Frauen von einem gelatinösen Super-Wurm erst vergewaltigt, dann zerbissen. Das alles ist zwar billig, aber effektiv getrickst, mit viel ekligen Gummi-Masken und -Kostümen und reichlich buntem Glibber. Und obwohl Freunde und Sympathisanten grobschlächtiger Schauwerte hier also definitiv auf ihre Kosten kommen, verkommt CURSE OF EVIL dabei erfreulicherweise nicht zur bloßen Nummernrevue der Scheußlichkeiten, sondern erzählt nebenbei auch tatsächlich noch eine durchaus brauchbare Geschichte.
Diese erinnert in Sachen Stil und Thematik überraschenderweise weniger an traditionelle Horror-Kost als viel mehr an altmodische Erbschaftsstreit-Kriminologie der Marke Edgar Wallace & Co. Das liegt zum einen am Schauplatz, der dekadenten Villa der Familie Shi, in der es von Gängen, Ecken und Verstecken nur so wimmelt, was sie zur formidablen Spielwiese für Intrigen aller Arten macht. Und zum anderen am illustren Personal, das hier aufgefahren wird und zum Teil so zwielichtig agiert, dass es das Publikums-Interesse zur Not auch im Alleingang, ganz ohne Monstren und Mutationen, hochhalten könnte. Beispiele wären der mehr als nur notgeile Vetter, der sich in der Kunst der Hypnose geübt hat und damit nun nichts Besseres anzufangen weiß, als die weibliche Belegschaft des Hauses zum Beischlaf zu nötigen, das blutjunge Flittchen, das es auf den neuen Hauslehrer abgesehen hat, der undurchsichtige Butler, der bei seiner Herrin ständig um Geld bettelt... Und über allem thront die matriarchalische Großmutter, auf deren Vermögen gleich mehrere Parteien scharf sind und die deswegen schon bald Opfer perfider Mordanschläge wird. Jede Menge Konfliktpotential also, das anständig genutzt wurde. Und immer, wenn die Handlung droht, auf der Stelle zu treten, kommen wieder ein paar blutige Frösche ins Bild, um für den nötigen Biss zu sorgen.
Natürlich bleibt CURSE OF EVIL in erster Linie ein effektheischender Reißer, der an die Schaulust des Publikums appelliert. Dass er dabei aber eine so auffallend überdurchschnittliche Figur abgibt, verdankt er dem geschickten Jonglieren mit Elementen anderer artverwandter Gattungen. Neben dem offensichtlich im Vordergrund stehenden Hardcore-Horror thematisiert das Skript auch den kulturell verfestigten chinesischen Geister-Glauben (sogar auf nicht unprovokante Weise), verwebt ihn mit eher europäisch geprägten Märchen-Motiven (am soundsovielten Geburtstag eines jungen Mädchens wird etwas Schreckliches passieren), um nach Ausflügen über besagte Krimi-Kategorie in einem Finale zu münden, das in puncto Ästhetik und Absurdität Assoziationen zum italienischen Giallo-Genre zulässt. Im Zelluloid-Sumpf Bewanderten drängen sich beizeiten noch weitere Querverbindungen auf; so erinnert die unschöne Vergewaltigung durch den Riesen-Wurm an den im Vorjahr entstandenen Sci-Fi-Horror PLANET DES SCHRECKENS und gemahnt gleichzeitig auch an diverse anrüchige Anime-Auswüchse (Doppeldeutigkeit unintendiert!).
Obwohl mit Obszönitäten nicht unbedingt haushaltend, kommt CURSE OF EVIL insgesamt doch erstaunlich unbekümmert daher – was verblüffend ist, denn unterm Strich handelt es sich ja schon um eine hochdramatische Geschichte voller Mord, Missgunst und Misanthropie. Dass einem alles irgendwie nur halb so wild vorkommt und der Spaß-Faktor stets die Oberhand behält, liegt daran, dass die Story ungeachtet erzählerischer Kompetenzen doch ausgemacht krude bleibt und überwiegend an eine Karikatur einschlägiger Schundliteratur erinnert. Die hier kredenzten Schauergestalten sehen im gleichen Maße scheußlich wie zum Schießen aus – wenn der fürchterliche Blutige Frosch erstmals ebenso träge wie dickwampig im Bild hockt, wirkt er wie eine verkaterte Zweitbesetzung der Muppet Show, die gerade dabei ist, ihren Rausch loszuwerden. Und dann gibt es da noch die englischen Untertitel, die mangels verfügbarer Synchronfassungen als Verständnis-Werkzeug dienen müssen und sich durchgängig über das Werk lustig zu machen scheinen. Es fällt schwer, die Situation ernstzunehmen, wenn ein Protagonist vor den Überresten eines frisch zerfetzten, von Kopf bis Fuß mit schleimigem Glibber besudelten Körpers steht und lapidar anmerkt, die junge Dame sei soeben „tragisch dahingeschieden“.

(Es ist übrigens nicht das einzige Mal, dass angesichts einer Leiche dieser Ausdruck fällt.)
An anderer Stelle fragt der Butler eine Angestellte ganz besorgt: „Qiao, ist dir klar, dass du brennst?“
(Unmittelbar danach wird es der Dame übrigens schlagartig bewusst. Gut, dass er gefragt hat:)
Und kurz vor Schluss kommt man noch mal in den Genuss einer ganz besonderen Konversation:
Großvater:
„Ich bin dein Großvater.“
Enkeltochter:
„Du bist mein Großvater?“
Großvater:
„Ja, ich bin dein Großvater. Meine Enkeltochter.“
Enkeltochter:
„Bist du wirklich mein Großvater?“
Großvater:
„Gutes Kind, ich bin dein Großvater.“
Enkeltochter:
„Großvater!“
Großvater:
„Gutes Kind.“
Enkeltochter:
„Großvater.“

(An dieser Stelle musste das Gespräch mangels Filmmaterials leider abgebrochen werden. Aber schön, dass das mal besprochen wurde.)
Auch dank solch schrulliger Eigenheiten ist CURSE OF EVIL ein ziemliches Brett geworden. Ein paar formale Fehlerchen fallen zwar auf, aber nicht weiter ins Gewicht. Sonderbar bleibt retrospektiv der zweimalige Kurz-Auftritt eines ohnehin reichlich unmotiviert hinzugezogenen Inspektors, der ein paar Fragen zum Fahrstuhl stellt, der geheimnisvollerweise ohne erkennbaren Grund mal rauf-, mal runterfährt, und dann auf Nimmerwiedersehen aus der Handlung verschwindet (also, der Inspektor – nicht der Fahrstuhl. Obwohl … Der eigentlich auch.) Es scheint, als hätte man die (sowieso sehr unpassend wirkende) Inspektor-Episode noch nachträglich entfernt und dabei einfach ein paar Szenen übersehen. Die im Hitchcock-Stil präsentierte Auflösung der Geschichte bietet zwar ein paar überraschende Erkenntnisse, ist aber in Teilen dermaßen haarsträubend, dass man kurz meint, sich verhört (bzw. verlesen) zu haben (was einem nicht zuletzt nochmals den Giallo als Inspirationsquelle ins Gedächtnis ruft, bei dem es nicht selten ähnlich abstruse Aha-Erlebnisse hagelt). Fazit: CURSE OF EVIL ist ein wunderbar schräges Stück Sensationskino-Kunst. Und wer das nicht glaubt, den frisst der Frosch.
Laufzeit: 80 Min. / Freigabe: ungeprüft











.jpg)